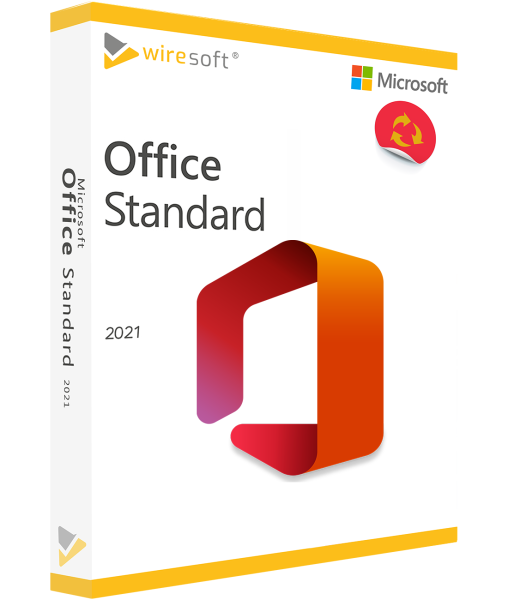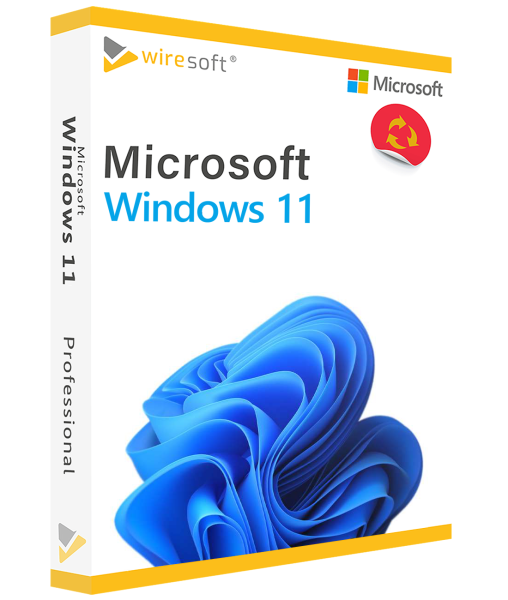1. Warum lohnt sich gebrauchte Software für öffentliche Auftraggeber?
Kosteneinsparung: Du nutzt vorhandene Lizenzen statt teurer Neulizenzen.
Nachhaltigkeit: Du trägst zu Ressourcenschonung und Umweltschutz bei.
Flexibilität: Du kannst ältere Versionen sichern, wenn dein IT-Betrieb diese verlangt.
Marktvielfalt: Du stärkst den Wettbewerb und ermöglichst Mittelstand und Wiederverkäufern faire Chancen.
2. Was ist der Erschöpfungsgrundsatz und warum gilt er für Software?
Der Erschöpfungsgrundsatz aus dem Urheberrecht (§ 69c UrhG) besagt: Nach dem ersten Verkauf darf der Hersteller den Weiterverkauf nicht untersagen.
Er greift für Datenträger und Downloads gleichermaßen.
EuGH und BGH bestätigen: Auch Volumenlizenzen und Download-Kopien fallen darunter.
3. Welche rechtlichen Grundlagen und Gerichtsurteile sind relevant?
EuGH C‑128/11 (2012): Download-Kopien sind materiell identisch mit Datenträgern.
BGH I ZR 244/97 (2000): Erschöpfung gilt unabhängig vom Vertriebskanal.
LG Hamburg 316 O 272/04 (2006): Erschöpfung einzelner Volumenlizenz-Copies.
UrhG § 69c: Rechtliche Verankerung im deutschen Gesetz.
4. Welche Vergabearten kommen infrage?
Offenes Verfahren: Ermöglicht breite Ausschreibung. Gebraucht-Lizenzen werden explizit zulässig gemacht.
Nicht offenes Verfahren (Teilnahmewettbewerb): Bei speziellen Anforderungen, aber nur unter engen Voraussetzungen.
Losaufteilung: Teilt Beschaffung nach Fachbereichen oder Softwarekategorien. So erreichst du kleinere Händler.
Freihändige Vergabe: Nur in Ausnahmefällen, wenn eng definierte Sonderfälle greifen.
5. Wie formulierst du die Leistungsbeschreibung korrekt?
Frage-Überschrift: „Welche Software-Versionen decken deinen Bedarf ab?“
Produktneutral: Keine Marken, keine Rahmenverträge, keine Vorzugslieferanten.
Nutzungsklassen: Server-, Arbeitsplatz-, Terminal-, virtuelle Lizenzen.
Downgrade-Rechte: „Der Erwerb gebrauchter Lizenzen und Downgrade-Rechte ist ausdrücklich zulässig.“
Rechtekette: „Der Bieter legt bei Lieferung die vollständige Rechtekette vor."
6. Wie definierst du Eignungs- und Zuschlagskriterien?
Erstvertrieb im EWR: Bestätigung, dass Erstverkauf im EU-/EWR-Raum erfolgte.
Angemessenes Entgelt: Nachweis eines marktüblichen Kaufpreises durch den Händler.
Unbefristete Lizenzrechte: Dauerhafte, nicht befristete Nutzungsrechte.
Rechtekette: Vollständigkeit und unmittelbare Übergabe bei Lieferung.
Freistellungserklärung: Händler übernimmt Risiken bei Herstelleransprüchen.
Fachliche Kompetenz: Erreichbarkeit, Support, technischer Ansprechpartner.
7. Wann und wie forderst du Nachweise an?
Zeitpunkt: Erst bei Lieferphase, nicht schon beim Angebot.
Form: Original-Kaufbelege, Endnutzererklärungen, Vertragspapiere.
Keine Hinterlegung: Verwerfe Konzepte wie "Depots bei Wirtschaftsprüfern".
Prüferrolle: Wirtschaftsprüfer bestätigen lediglich Vollständigkeit, nicht Richtigkeit.
8. Warum ist direkte Übergabe der Rechtekette Pflicht?
Transparenz: Du beurteilst Lizenzhistorie selbst.
Warnsignal: Hinterlegung bei Dritten kann auf Verschleierung hinweisen.
Rechtssicherheit: Herstelleransprüche lassen sich bei vollständiger Kette besser abwehren.
Dokumentenmanagement: Du legst alle Belege direkt in dein Vergabe- und Dokumentationssystem.
9. Welche Rolle spielen Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte?
Keine zentralen Verwahrer: Sie prüfen Vollständigkeit, nicht inhaltliche Korrektheit.
Kostenfalle: Hohe Prüfkosten verzerren Preiswettbewerb.
Missbrauchspotenzial: Händler können Prüfer als Vertrauensmantel nutzen, um Schwächen zu verbergen.
10. Welche Fallstricke vermeidest du?
Geheime Belege: Verlange keine verschleierten Lizenznummern.
Pauschale Versicherungen: Achte auf konkrete Freistellungs- und Gewährleistungsklauseln.
Unverhältnismäßige Anforderungen: Vermeide Anforderungen, die nur große Konzerne erfüllen können.
NDA-Fallen: Keine Geheimhaltungsvereinbarungen um Lizenzdetails verdeckt auszutauschen.
11. Wie sicherst du dich bei Herstelleransprüchen rechtlich ab?
Freistellungserklärung: Konkrete Klausel im Vertrag.
Haftung und Vertragsstrafen: Für unvollständige oder fehlerhafte Rechtekette.
Gewährleistung: Rügefristen (§ 377 HGB) im Vertrag regeln.
Schadensersatz: Vereinbare Haftungsobergrenzen und Versicherungen.
12. Welche Musterklauseln nutzt du?
Vergabeunterlage: "Der Bieter übergibt bei Lieferung sämtliche Originalunterlagen zur Rechtekette. Er übernimmt die Freistellung im Falle von Ansprüchen Dritter."
Rahmenvertrag: "Die Parteien vereinbaren, dass gebrauchte Lizenzen nur nach vollständiger Offenlegung der Rechtekette geliefert werden."
Vergütungsregelung: "Zahlung erfolgt erst nach Nachweis und Prüfung der Rechtekette."
13. Wie durchläufst du den Beschaffungsprozess Schritt für Schritt?
Bedarfsermittlung: Erstelle ein Inventar der benötigten Software-Lizenzen.
Marktrecherche: Identifiziere potenzielle Händler und Plattformen.
Ausschreibungsentwurf: Formuliere Frage-Überschriften und Produktneutralität.
Veröffentlichung: Lade Unterlagen in dein Vergabeportal hoch.
Fragen und Antworten (Bieterdialog): Kläre Unklarheiten.
Auswertung der Angebote: Prüfe Vollständigkeit und Plausibilität der Rechtekette.
Vertragsabschluss: Integriere Freistellungs- und Gewährleistungsklauseln.
Lieferung und Abnahme: Fordere direkte Übergabe der Dokumente.
Zahlung: Nach vollständiger Prüfung der Kette.
14. Wie dokumentierst und archivierst du korrekt?
Verzeichnis aller Lizenzen: Version, Anzahl, Seriennummern.
Dokumentenmanagementsystem (DMS): Scans und digitale Originale.
Vergabeakte: Protokolle, E‑Mails, Bescheide.
Abnahmeprotokoll: Vollständigkeit der Rechtekette bestätigen.
15. Wie gehst du mit Nachprüfungen und Audits um?
Interne Revision: Beziehe IT- und Rechtsabteilung ein.
Externe Audits: Prüfer dürfen nur Vollständigkeitsbescheinigungen anfordern.
Nachforderungen: Reagiere zeitnah und dokumentiere Antworten.
16. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es?
Beispiel Stadtverwaltung X: 40 % Kosteneinsparung durch Downgrade-Rechte.
Beispiel Landkreis Y: Erfolgreiche Losaufteilung nach Fachbereichen.
Beispiel Behörde Z: Klare Freistellungsklauseln schützen vor Herstelleransprüchen.
17. Wie verhinderst du Blackbox-Modelle?
Offene Bieterkommunikation: Dialog ermöglicht Transparenz.
Präzise Anforderungen: Rechtskette „unverzüglich bei Lieferung“.
Kein Drittverwahrer: Verwerfe Konzepte mit Wirtschaftsprüfern als Mutter aller Fehler.
18. Wie vermeidest du technische Risiken?
Technische Mindestanforderungen: Kompatibilität, Supportfähigkeit, Sicherheitsupdates.
Test-Installationen: Vorab-Test in isolierter Umgebung.
Sicherheitspatches: Beziehe Patch-Status der gebrauchten Software mit ein.
19. Wie gestaltest du den Liefer- und Abnahmeprozess?
Lieferavis: Bieter kündigt Dokumentenübergabe an.
Unterlagenbestand: Checkliste aller Original-Belege.
Abnahmegespräch: Verprotokollierung und Bestätigung.
Freigabe zur Zahlung: Nach erfolgreicher Abnahme.
20. Abschließende Checkliste für deinen Erfolg
Bedarf, Verfahren, Beschreibung festgelegt.
Eignungs- und Zuschlagskriterien definiert.
Freistellungs- und Gewährleistungsklauseln integriert.
Rechtekette unverzüglich direkt bei Lieferung.
Dokumentation und Archivierung vollständig.
Abnahme und Zahlung klar geregelt.
Warnung: Keine Hinterlegung der Rechtekette bei Dritten zulassen
Stell dir vor, du kaufst ein Auto. Der Fahrzeugbrief wird dir sofort ausgehändigt. Dort steht der Vorbesitzer klar erkennbar. Warum sollte es bei Software anders sein?
Wenn ein Händler verlangt, deine Lizenz-Dokumente kostenpflichtig bei einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt „zu hinterlegen“, ist Vorsicht geboten. Meist steckt dahinter der Versuch, unwirksame oder unvollständige Rechte zu verschleiern. Denn:
Vollständiger Abschluss vor Ort möglich
Du kannst den Auftrag vollständig abschließen, indem dir der Händler bei Lieferung die gesamte Rechtekette übersendet und übergibt. Ein teures Depot bei Dritten ist dafür nicht nötig.
Falsche Sicherheit bei Insolvenz
Ein Argument für die Hinterlegung lautet oft, bei Insolvenz des Händlers seien deine Unterlagen geschützt. Doch wenn der Händler pleitegeht und die Dokumente später im Audit als fehlerhaft oder manipuliert entlarvt werden, steht niemand mehr für die Richtigkeit ein. Du kannst den insolventen Händler nicht belangen – und der Wirtschaftsprüfer hat nur verwahrt, nicht geprüft.
Prüfer prüfen nur Vollständigkeit, nicht Richtigkeit
Wirtschaftsprüfer bestätigen allenfalls, dass alle Papiere vorliegen. Sie überprüfen nicht, ob die Dokumente echt oder gesetzeskonform sind. Eine Manipulation bleibt unentdeckt, bis es zu spät ist.Verlange stets die direkte Übergabe aller Original-Belege zur Rechtekette bei Software-Lieferung. So sicherst du dir maximale Transparenz und verhinderst, Opfer eines Lizenz-Betrugs zu werden.
Mit diesem detaillierten Leitfaden bist du 2025 in der Lage, gebrauchte Software rechts- und vergaberechtlich sicher zu beschaffen. Er führt dich strukturiert durch alle Phasen und minimiert Risiken. Viel Erfolg bei deiner Beschaffung!